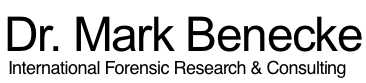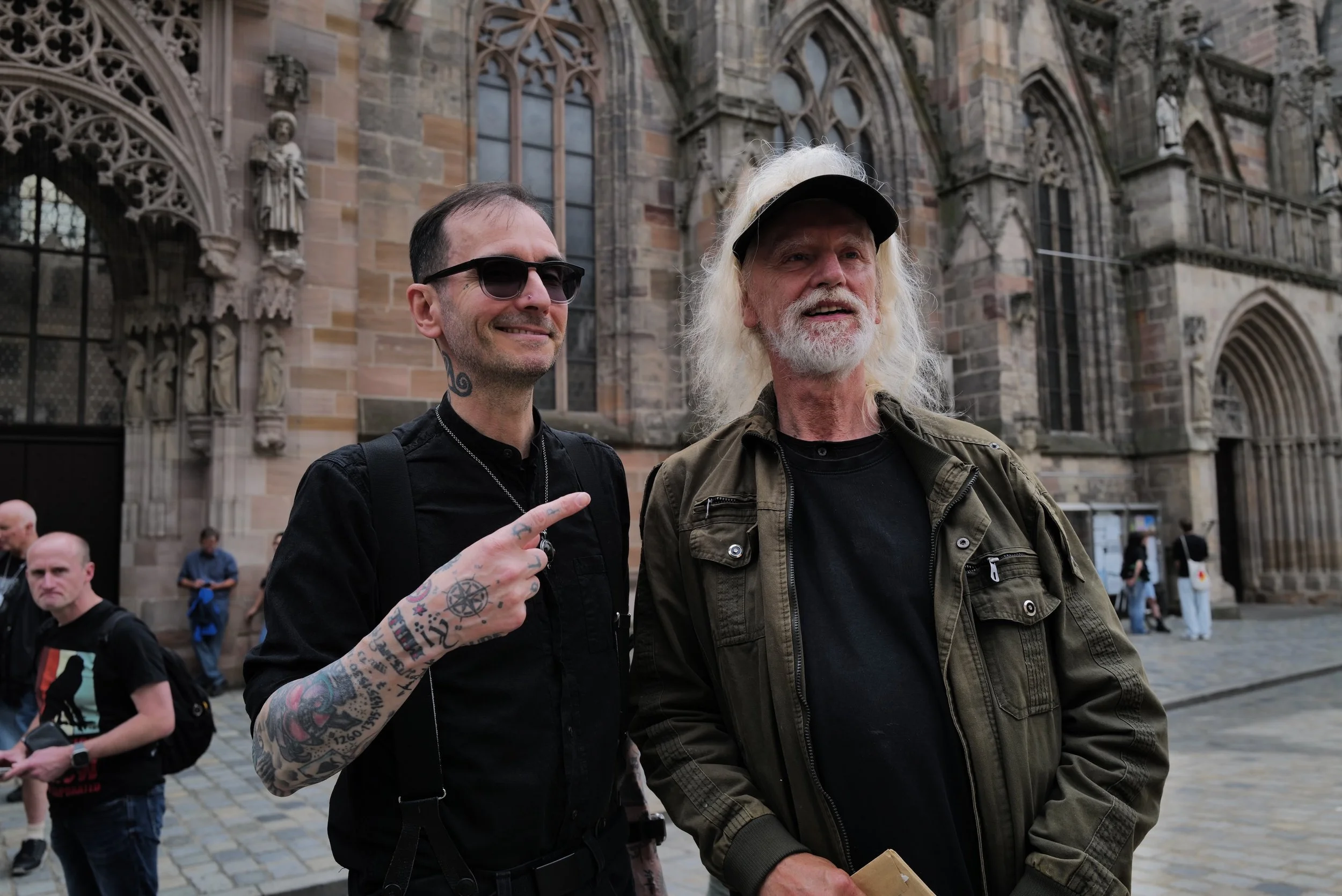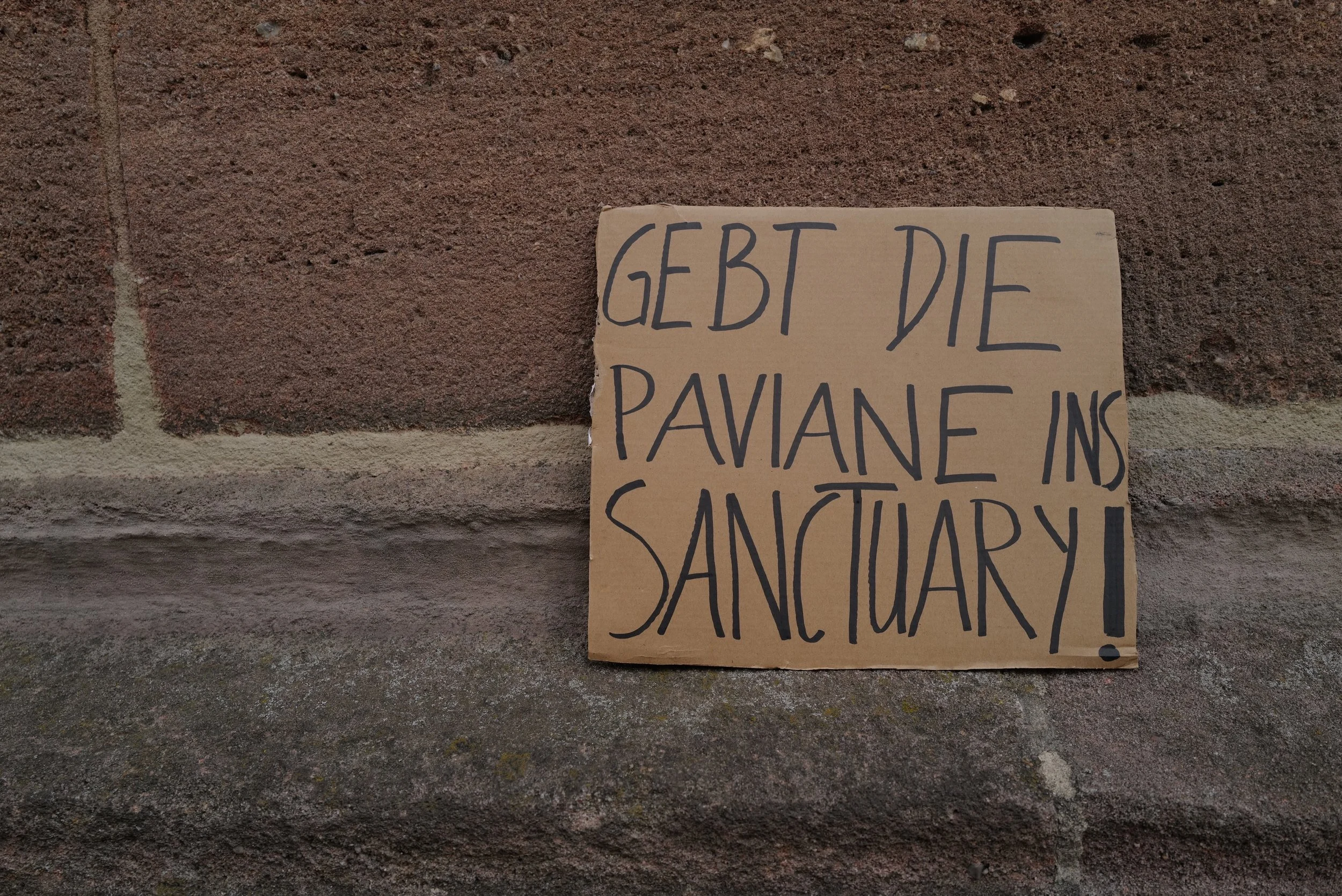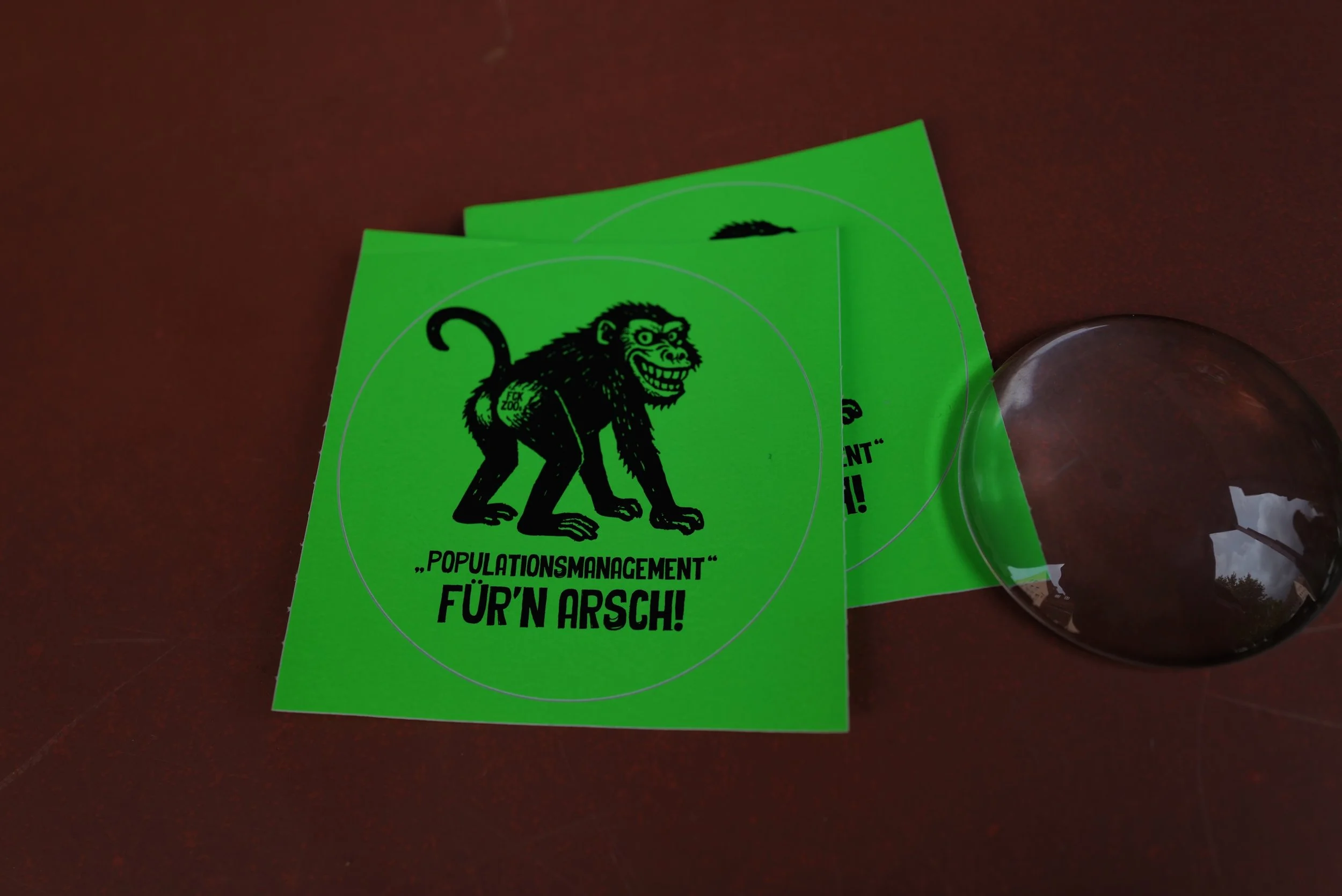Herr Benecke, Sie sind Kriminalist und befassen sich mit der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Eine Frau, wie am Hamburger Bahnhof Ende Mai geschehen, sticht mit einem Messer mutmaßlich wahllos auf Passagiere ein. Ein Mann rast im Dezember mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Auf einem Stadtfest in Solingen geht ein Mann im vergangenen Jahr mit einem Messer auf die Besucher los. Wer macht so was, wer verletzt oder tötet wahllos so viele Menschen wie er erwischt, die er nicht einmal kennt?
Dass Rache suchende Amokläufer oder politisch motivierte Terroristen Orte aufsuchen, an denen sie möglichst viele Menschen töten können, kennen wir leider inzwischen. Bei Fällen wie in Hamburg, Magdeburg oder Solingen geht es aber um Täter, bei denen die Motive nicht so leicht nachzuvollziehen sind, die Wahl der Opfer ist scheinbar zufällig.
Was kann man über die Täter sagen?
In der Regel lassen sie sich drei Gruppen zuordnen. Die eine Gruppe, das sind häufig Leute, die ein komplett kaputtes Leben haben, als Kinder keine gute Bindung erlebt haben, vielleicht sexuell oder geistig missbraucht wurden. Als Erwachsene sind das oft die, die sich über viele Dinge stark aufregen und leicht reizbar sind. Manche werden auch depressiv. Oder beides. In vergleichsweise harmloser Form kennt man das von Alkoholikern oder Leuten, die andere Substanzen nehmen, Heroin oder synthetische Drogen, die an Bahnhöfen abhängen, sich selbst hassen oder ihre Eltern oder die Welt. Die rumbrüllen, sich streiten, aggressiv sind – aber meistens ungefährlich. Rasten sie dann aber doch mal ausnahmsweise aus, greifen sie offenbar wahllos Menschen an oder bringen jemanden um, der gerade in der Nähe ist, Zufallsopfer.
Und die zweite Gruppe?
Das sind Leute mit Psychosen, also Menschen mit psychischen Erkrankungen, die nicht unterscheiden können, was wirklich ist und was eigene, verzerrte oder eingebildete Empfindung. Der Klassiker ist, dass sie Stimmen hören oder Farben sehen, die gar nicht da sind, manche fühlen sich von Geheimdiensten oder fremden Wesen verfolgt oder meinen Botschaften aus einer anderen Welt zu empfangen, die anderen nicht zugänglich ist. Auch bei ihnen kann das zufällig wirken, wenn sie andere angreifen, Leute töten.
Die dritte Tätergruppe sind Menschen mit „überstarken Überzeugungen“, wie Sie sagen.
Ja, das sind die, die mit dem Auto in eine Menschenmenge fahren oder in einer Ansammlung von Menschen herumschießen. Wie der norwegische Massenmörder Anders Breivik, der im Sommer 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet hat. Bei ihm waren sich die Gutachter und Gutachterinnen allerdings nicht einig, ob er psychisch krank ist oder eine übermäßig starke politische und soziale Überzeugung hat.
Und sie alle attackieren ihre Opfer wirklich zufällig?
Nehmen wir Psychotikerinnen und Psychotiker. Es wirkt vielleicht zufällig, an welchem Ort sie auf Menschen losgehen, aber da ist oft „method behind the madness“, da steckt aus ihrer Sicht ein guter Grund dahinter. Psychotische Täter sind immer verrückt, halluzinieren, haben Wahnvorstellungen. Sie töten aber nicht ganz so wahllos, wie es von außen wirkt.
Sehr häufig gehen sie auf Menschen los, vor denen sie sich erschrecken, vor denen sie Angst haben, die für sie vielleicht komisch gekleidet sind, eine seltsame Bewegung gemacht haben, aus ihren Augen zu irgendeiner Verschwörung gehören, zu Reptilienmenschen, Aliens oder sonst irgendetwas.
Ist der Tatort zufällig?
Jemand, der mit und wegen der Krankheit die soziale Leiter runtergefallen ist, wird nicht in einer Luxusvilla auftauchen und dort auf Menschen losgehen. Und andersherum wird jemand, der in einer Luxusvilla lebt und eine Psychose bekommt, eher sehr gut ärztlich versorgt – und meist nicht am Bahnhof landen und dort Täter werden.
Die überstark Überzeugten werden genau wissen, wen sie umbringen wollen.
Das haben wir gerade wieder bei den Attentaten auf Politiker der US-Demokraten in Minnesota gesehen.
Sind sich die meisten bewusst, warum sie Täter geworden sind?
Stark persönlichkeitsgestörte Menschen handeln technisch gesehen bewusst, die wahren, inneren Gründe ihres Handelns sind ihnen aber wohl trotzdem nicht so richtig bekannt.
Warum töten manche Menschen, die ein kaputtes Leben haben, eine Psychose oder eine extrem starke Überzeugung – und andere, die auch ein kaputtes Leben haben, eine Psychose oder eine extrem starke Überzeugung, töten nicht?
Das ist die ganz große Frage. Sieht man sich die Lebensgeschichte solcher Menschen an, findet man aber oft Hinweise darauf.
Nämlich?
Am Ende des Tages fehlt es Täterinnen und Tätern oft an einer Art Schutz. Denn selbst wenn sie verrückt sind oder persönlichkeitsgestört, wenn sie abdriften, weil sie einsam alleine zu Hause sitzen und glauben, die Welt retten zu müssen, selbst wenn sie Präsident der Vereinigten Staaten sind: In den allermeisten Fällen haben Leute Schutzfaktoren, die sie davor bewahren, die Grenze zum Töten zu überschreiten. Diese Faktoren machen standhaft dagegen, auszurasten.
Was sind solche Schutzfaktoren?
Schutz gibt es Menschen beispielsweise, wenn sie in ihrem Leben jemanden haben, auf den sie sich verlassen können.
So einfach ist das?
Klingt einfach, ist aber gar nicht so selbstverständlich, wie man glauben könnte.
Ein Beispiel, bitte.
Nehmen wir an, du hast eine Psychose. Der Klassiker wäre, weil das einen starken erblichen Anteil hat, dass schon deine Eltern erkennbar verrückt sind. Verlässlichkeit in der Familie gab es also eher nicht. Aber vielleicht nimmst du an einem Programm teil, das es in vielen Städten gibt, und erlebst Verlässlichkeit, in dem du zum Beispiel immer mittwochs um 15 Uhr und samstags um 18 Uhr eine Familie, so etwas wie eine Patenfamilie, besuchst. Egal, was passiert, du gehst da immer hin. Und wenn sich dann die Psychose anbahnt, hast du so etwas wie einen Anker in der „echten“ Welt, der dich festhält, sodass du nicht durch Stress schnell weiter abdriftest.
Und bei Persönlichkeitsgestörten?
Auch Persönlichkeitsgestörte, zum Beispiel Narzissten, kann eine starke Bindung teils schützen. Bei dem heute weltweit bekanntesten Narzissten, Donald Trump, zum Beispiel konnte man während seiner ersten Präsidentschaft noch denken, dass seine Tochter Ivanka so etwas für ihn ist – sie war damals seine „Beraterin“. Man konnte denken, dass er eine gute Bindung zu ihr aufrechterhalten will, sie stolz auf ihn sein soll. Und in ganz kleinem Maß hat sie ihm vielleicht noch ihre Meinung sagen können, vielleicht hat er ihr damals auch manchmal zugehört. Es sind sehr kleine Handlungsspielräume, um die es hier geht.
Hat jemand mit Persönlichkeitsstörung einmal erlebt, dass eine Bindung stabil, zuverlässig und vertrauensvoll sein kann, fühlt sich das für sie oder ihn angenehm und beruhigend an, wie für andere Blätterrauschen oder Vogelgesang. Es gibt Geborgenheit. Und auch ein bisschen Vertrauen in die Menschen und das Leben im Allgemeinen. Solche Bindungen halten Leute zwar nicht davon ab, ein Narzisst zu sein oder überstarke Überzeugungen zu entwickeln. Aber vielleicht hält es sie davon ab, mit dem Auto in eine Menschenmenge zu fahren.
Schuld ist zu einem großen Teil die schlechte Kindheit?
Erfahren Kinder, dass sie wertvolle Menschen sind, dass man ihnen zuhört, ihnen auf Fragen, die sie stellen, ernsthaft antwortet, schützt sie das zumindest mehr, als wenn sie nicht ernst genommen werden und alleine dastehen. Warum sind da weiße Linien auf der Straße? Warum hängt da ein gelber Kasten an der Häuserwand? Hört ein Kind dann auf solche Fragen, „Mein Gott, wo kommst du denn her? Bist du dumm! Das weiß ja jeder, das sind Zebrastreifen und ein Briefkasten“. Dann ist klar, was dabei rauskommt: ein an sich selbst zweifelnder Mensch, der kein Vertrauen in die Welt hat – und eher keine schützende Einflüsse erlebt.
Oder wenn ein Kind traurig ist und zu seinen Eltern geht, die zwar vielleicht weiter Netflix gucken, es aber trotzdem in den Arm nehmen. Dann lernt es, dass es kein Drama machen muss, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das schützt es.
Sind die Täter oft einsame Nerds?
Zumindest halten sie sich in der Tiefe ihres Herzens für winzig und unbedeutend. Jeder Mensch hat sein Plätzchen auf der Welt, das ist vergleichbar mit einem mehr oder weniger großen Sandkorn in der Wüste. Manche Leute kommen nicht damit klar, dass sie glauben, keine Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, um jemand Größeres und Wichtigeres zu werden. Kommt dann noch eine Persönlichkeitsstörung dazu, wie eine antisoziale Störung oder Narzissmus, kann das leicht schiefgehen, weil Menschen dann eher keinen Schutz davor haben, auszurasten.
Und mit einer überstarken Überzeugung meinen solche Menschen, rauszukommen aus dem Leben als Sandkorn?
Es ist ganz klar, was solche Leute denken: Keiner kümmert sich um mich, niemand redet mit mir, ich bin total einsam – aber jetzt auf einmal hören sie mir zu! Die einen regen sich zwar auf über meine Überzeugung, die anderen finden mich aber toll. Meine Kommentarspalten in den sozialen Medien sind bis zum Platzen voll, super. Solche Abläufe sind selbstverstärkend.
Was läuft falsch, wenn jemand denkt, dass seine Art, die Welt zu sehen, für alle acht Milliarden Menschen auf der Erde die einzig richtige ist?
Na ja, schauen wir uns mal die Helden- und Heldinnen-Filme an, in denen genau das passiert. Wir alle sind damit aufgewachsen, dass die Tollen und Heldenhaften in 99 Prozent der Fälle ihrem Super-Ich folgen und anderen ihre Sicht der Welt aufzwingen. Das scheint also wirklich erstrebenswert zu sein. Der Kühnste, die Kühnste, rettet die Welt.
Hat es Massentötungen schon immer gegeben? Oder ist unsere Gesellschaft heute so schräg, dass es mehr Leute gibt, die keine Schutzfaktoren haben?
Soweit man das in der kriminalistischen Literatur überschauen kann, gibt es das, seit mutwillige Verletzungen, Mord und Totschlag in der menschlichen Gesellschaft dokumentiert werden.
Richtig untersucht wurde das bisher allerdings nur im Bereich von Amokläufen, die es ja auch schon immer gab. Aber Täterinnen und Täter, die in ihre eigenen oder fremde Schulen gehen, um sich angeblich zu rächen, oder sonstigen Antrieben folgen, oder, wie gerade in Bayern geschehen, Menschen in der Firma verletzen oder töten, handeln in einer anderen kulturellen Umgebung als Amok-Täterinnen oder -Täter vor langer Zeit an einem anderen Ort der Welt. Das ist aus heutiger Sicht nicht immer gut zu vergleichen, auch wenn es ähnlich aussieht und es vielleicht Ähnlichkeiten geben mag.
Was heute solche Schuss- und Messerattentate sind, waren früher Tötungen mit Schwertern oder Äxten. Damals ist so etwas vielleicht auch weniger aufgefallen, weil die Menschen, je nach Kultur, sowieso recht kriegerisch sein konnten. Und es war ja auch, je nach Lage vor Ort, nichts wirklich Besonderes, im Kampf zu sterben oder anderweitig getötet zu werden.
Da sind wir wieder bei Anders Breivik, der auch das persönliche, massenhafte Erschießen und „Jagen“ interessant fand. Solche Fälle jedenfalls sind auch aus vorangegangenen Jahrhunderten belegt.
Dass psychisch kranke Menschen andere attackieren, wie die Frau am Hamburger Hauptbahnhof, ist das ein zunehmendes Phänomen?
Das kommt immer wieder vor. 2019 hat ein psychisch kranker Mann am Frankfurter Hauptbahnhof einen Achtjährigen und seine Mutter ins Gleisbett gestoßen, im vergangenen Februar hat dort eine offenbar psychisch kranke Frau einen Mann auf die Gleise geschubst. Meistens sind es psychotische Menschen, die solche Taten begehen.
Heute erleben ein bis zwei Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung mindestens einmal im Leben eine Psychose. Nimmt die Zahl zu?
Psychosen treten gehäuft bei Menschen auf, die sehr, sehr starke Traumatisierungen haben, zum Beispiel bei Geflüchteten, die durch ganz Afrika gewandert sind, dabei noch entführt und sexuell missbraucht wurden. Dann in irgendeinem Land gestrandet sind, von dort wieder über die Grenzen geschoben wurden, in einem Lager landeten, oft ohne jegliche Privatsphäre. Mit so einer Lebensgeschichte haben sie ein deutlich höheres Risiko, eine Psychose zu bekommen. Die Trauma-Belastung führt zum Durchbruch.
Sind Menschen, die brutale Videospiele spielen, gewaltbereiter?
Ich kenne keine kriminalistische Studie, auch keine psychologische oder psychiatrische, die zeigt, dass Computer irgendetwas mit der Gewaltbereitschaft in der „echten Welt“ zu tun haben.
Einsame oder verbitterte Menschen oder solche, die keine Bindungen im echten Leben aufbauen können, mögen vielleicht manchmal mehr über dem Rechner hängen. Aber das eine ist die Frage nach der Ursache, das andere die nach der Ausprägung von Gewaltbereitschaft.
Sind wir also gar nicht gewalttätiger als frühere Gesellschaften?
Was sich verändert hat, ist, dass Leute, die sich radikalisiert haben, auf Websites gehen, wo sie viele Tipps finden für Attentate. Das hat es früher so nicht gegeben. Heute können sie sich in aller Seelenruhe einlesen und kriegen noch eine persönliche Beratung, wie sie andere am besten umbringen können.
Emotionale Stabilität, Bildung, menschenwürdige Lebensverhältnisse, was kann die Gesellschaft noch tun, um zu verhindern, dass Leute ausrasten?
Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wollsockenmäßig an, aber es ist kein Gelaber: für mehr sozialen Ausgleich sorgen, dafür, dass jeder Mensch die Möglichkeiten hat, aus sich herauszuholen, was er oder sie will, dass das Geld und Steuern gerechter verteilt sind, der öffentliche Personennahverkehr günstig und für jeden nutzbar ist, dass es eine echte, nicht nur erfundene Mietpreisbremse gibt, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Gesundheit und soziale Hilfsprogramme für Menschen, die alleine nicht klarkommen. All das hilft, dass es weniger Zornige und Gestresste gibt.