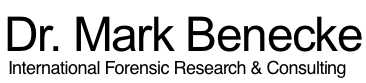Er machte die wissenschaftliche Forensik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Seine Vorträge füllen seit vielen Jahren ganze Säle und zeichnen sich durch seine humorvolle Art aus, mit der er von seinen Mordermittlungen, von Verwesung oder auch Vampirismus erzählt. Der Kölner Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke ist Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren und untersuchte unter anderem Adolf Hitlers Schädel. Darüber hinaus engagiert er sich im Vorstand des Vereins White Unicorn für Menschen mit Autismus und hat erkannt: Autismus und ADHS haben viel gemeinsam und treten oft gemeinsam auf. Das ADHS-Journal sprach mit ihm darüber.
ADHS-Journal: Du engagierst dich seit Jahren leidenschaftlich für das Thema Autismus, setzt dich inzwischen zunehmend auch mit ADHS auseinander und betonst die Gemeinsamkeiten, die Überschneidungen. Kannst du die wesentlichsten einmal nennen?
Dr. Mark Benecke: Vielleicht besonders leicht zu erkennen: die »Vergesslichkeit«. Bei eher Richtung ADHS gehenden Menschen wären das beispielsweise die typischerweise liegen gebliebenen oder urplötzlich »verschwundenen« Gegenstände oder Vorhaben. Bei eher autistischen Menschen geschieht Ähnliches, wenn Überforderung durch Umweltreize beziehungsweise zu vielen Anfragen eintritt: Alles kommt durcheinander, geht verloren, wird vergessen.
Es gibt noch sehr viel mehr. Ich will nur noch drei Gemeinsamkeiten nennen: Tiefes Einfühlungsvermögen in andere, das sich aber nicht immer so äußert, wie angeblich Normale es gerne hätten. Harte Abneigung gegen Lügen. Und natürlich ausufernd erscheinende Lieblingsbeschäftigungen, sehr ausgeprägte Essensvorlieben und dergleichen Vertiefungen und »Tunnel«.
Es ist noch gar nicht lange her, da schlossen sich Autismus und ADHS als Diagnose gegenseitig aus. Das hat sich grundlegend geändert. Sogar von AuDHS ist manchmal die Rede. Was genau steckt dahinter?
Meine Frau Ines meinte gestern, als ich unbedingt noch eine Runde mit dem Rad fahren »musste«, also wollte, und sie lieber zum Arbeiten mit dem Laptop ins Bett ging (wir haben privat keine Couch oder Sessel oder Ähnliches): »Was wäre, wenn Autistinnen und Autisten ADHSlerinnen/ADHSler mit wenig Muskelspannung sind?«
Ich würde es eh aufweiten: Wenn es schon »neuridivergente« Menschen geben soll – ich habe bisher noch nie eine »neurotypische« Person getroffen, glaube ich –, dann ist das Ganze eine Wolke mit vielen Achsen menschlicher, eingeschlossen darin auch körperlicher Eigenschaften darin. Natürlich überlappt sich darin vieles, auch mit Posttraumastörungen, die sich leider sehr viele Neurodivergente »einfangen«, schlechtes Lesen und Schreiben, Synästhesie und Vielem mehr.
Kann man ADHS denn von Autismus überhaupt noch klar abgrenzen? Oder ist jeder ADHSler gleichzeitig Autist und jede Autistin hyperaktiv und/oder aufmerksamkeitsgestört?
Wo verläuft die Grenze? Und wo liegt die Grenze zum »Normalen«? Das ist unscharf, siehe oben.
Den Störungs-Begriff würde ich nicht verwenden, da er beliebig ist. Meist stören sich ja andere an Wünschen und Gewohnheiten, die ihnen recht egal sein könnten: »Iss nicht immer dasselbe«, »warum musst du den Pfirsich schälen, die Schale ist so gesund«, »so kannst du nicht sitzen, man sitzt anders«, »das im Internet sind keine echten Freundinnen«, »mich stört das helle Licht nicht, daher dimme ich es nicht herunter«, »es ist normal, über das Wetter zu plaudern, aber du darfst auf keinen Fall vertiefte Informationen zum Ablauf und zur Entstehung von Wetterereignissen liefern«, »jetzt machen wir aber nur wegen dir nicht noch eine weitere Pause«, »bitte hör auf, mit den Kindern auf der Familien-Feier zu spielen, und setz dich zu Oma und Opa« und so weiter.
Viele Erwachsene, die erstmals von ihrer Neurodivergenz erfahren, sind geradezu erleichtert, weil die Diagnose nicht selten so ziemlich alles, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, erklären kann. Oft haben sie bis dahin schon einen langen Leidensweg hinter sich, weil ihre Symptome als psychische Krankheit fehlgedeutet wurden und nicht als neurologische Besonderheit wie ADHS und Autismus. Was empfiehlst du zur besseren Sensibilisierung?
Sei ehrlich zu dir selbst! Wenn die Merkmale aus den ganzen Neurodivergenz-Memes auf dich zutreffen, dann bist du eine oder einer von uns! Die »amtliche« Diagnose kann dir helfen; aber wenn du keine möchtest und aus welchem Grund auch immer gut klarkommst, dann lass es.
Welche Symptome sollten sich Betroffene und Therapeutinnen oder Therapeuten genauer ansehen? Was wird immer wieder übersehen, wodurch es zu den zahlreichen Fehldiagnosen kommt?
In die Augen schauen … Mein Gott, ich kann es nicht mehr hören. Natürlich können Neurodivergente anderen in die Augen schauen! Ich habe es beispielsweise als Kind durch Zufall in einem ganz allgemeinen Buch über Vorträge und gesellschaftliche Formen gesehen (so was gab es früher in vielen Haushalten): »Schau anderen, aber nicht zu lange, genau zwischen die Augen. Nicht zwischen den Augen hin und her pendeln.« Mache ich seitdem so. Die Frage ist, ob es anstrengend ist, nicht, ob es möglich ist. Leider höre ich das auch heute noch fast täglich von Autistinnen und Autisten, die wohl zu einer unerfahrenen Diagnosestelle gegangen sind.
Und natürlich Überforderung: Die ist echt. Und sie kann zahlreiche Quellen haben. Also erst mal zuhören, bitte!
Ich möchte aber auch erfahrene Diagnostikerinnen und Diagnostiker sehr stark loben: Die lassen sich nicht von Annahmen leiten, sondern von modernen Erkennungsmerkmalen und messbarer Erfahrung. Die Erleichterung nach einer zutreffenden, nicht irgendeiner Neurodivergenz-Feststellung ist für die Untersuchten superwichtig. Sie ist nur dann erleichternd, wenn sie genau stimmt, nicht »irgendwie«.
Beide sogenannten Störungen werden trotz aller Aufklärung weiterhin stark stigmatisiert. Wie könnte man das deiner Meinung nach ändern?
Ich kenne schlechtes Gerede darüber nur vom Hörensagen. Das liegt vermutlich daran, dass ich Aussagen, die auf Meinungen statt auf Messungen beruhen, nicht zuhöre. Ich habe nur ein Leben.
Vielfach ist ja sogar von vermeintlichen Modekrankheiten die Rede, weil eine objektive Diagnose gar nicht möglich sei. Was sagst du Menschen, die das behaupten?
»Zeig mir die wissenschaftliche, neue Studie dazu!« Bisher habe ich keine dazu gesehen.
Wird es denn in absehbarer Zeit eindeutige Diagnosemöglichkeiten geben, Stichwort KI-gestützte Netzhautscans oder spezielle MRT-Untersuchungen?
Denke ich schon: Es könnte ein großer Markt und damit zum Geld verdienen interessant sein. Aus Menschlichkeit wird’s wohl nicht zu Ende entwickelt werden.
Glaubst du, dass auch die Ursachen und nicht nur die Symptome irgendwann einmal behandelt werden können, mit oder ohne Medikamente?
Können sie: indem die Umwelt sich freundlich verhält! Viele »Symptome« sind nur Überlastungszeichen, die jeder Mensch früher oder später bei Stress von außen entwickelt. Bei Neurodiversen geht es halt schneller oder durch andere Reize.
Bei ADHS fühlen sich viele auch durch die bekannten Aufputschmittel entlastet, die verschrieben werden. Muss man ein bisschen ausprobieren und schauen, ob es wirklich erleichternd wirkt; das ist aber öfter der Fall.
Ansonsten: Genau zuhören, was die neurodivergenten Menschen sagen oder aufmalen oder aufschreiben und wie sie den Stress mindern. Das ist keine Meinung, sondern auch von unserem Verband »White Unicorn« zusammen mit der Goethe-Universität in Frankfurt/Main, der Humboldt-Universität in Berlin, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der »Aktion Mensch« mit Tausenden von befragten »Normalen« und Neurodivergenten erforscht.
Das kann auch anstrengend sein, wenn die Kids sich – eher bei mehr autistischen Menschen – beispielsweise nicht die Zähne putzen oder sich nicht waschen oder immer dieselbe Hose anziehen wollen. Es gibt dafür aber einen guten (!) Grund, das wird megaoft vergessen: Der Geschmack der Minze in der Paste, die Härte der Borsten, das Vibrieren der elektrischen Bürste – muss ja alles nicht sein, es geht auch ohne das alles mit anderer Paste, anderer Bürste und ohne Strom – zack!
Oder die »Ungeduld« bei eher in Richtung ADHS gehenden Menschen: Oft haben sie tatsächlich schon nach vier Worten verstanden, worum es geht. Ist doch okay! Wenn sie das beweisen können, dann lass sie doch einfach in Ruhe und versuch nicht, ihnen dein Lernprogramm für »Normale« aufzudrücken.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, Mark!