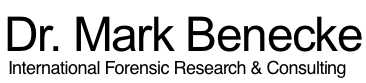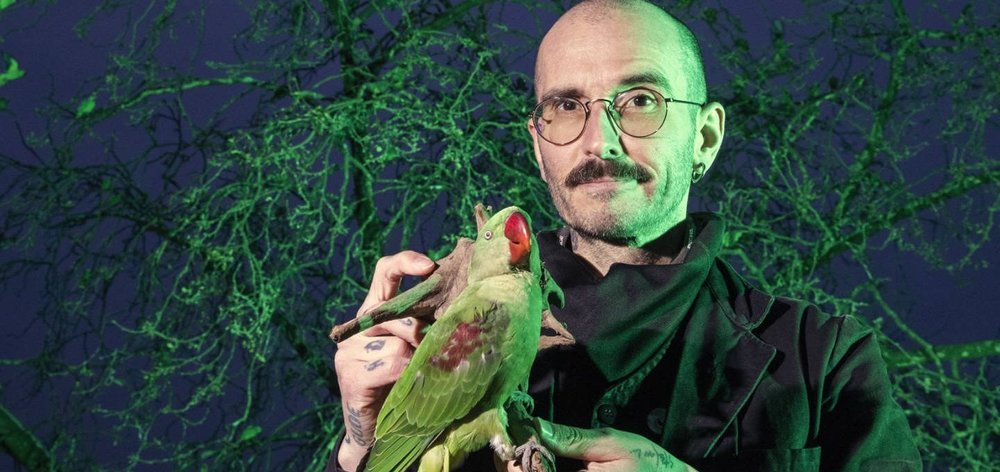Quelle: NABU Stadtverband Köln mit freundlicher Genehmigung von Jana Romero
Foto: NABU Stadtverband Köln
1. Die Sittiche breiten sich ungehemmt aus
Nein, das trifft zumindest so pauschal nicht zu. Sittiche benötigen bestimmte klimatische Voraussetzungen und die finden sie bisher nur in den wärmebegünstigten Regionen des Rheinlands, des Rhein-Main-Gebiets und der Rhein-Neckar-Region. Deshalb kommen zum Beispiel in den an das Rheinland angrenzenden Mittelgebirgen bisher keine Sittiche vor. Außerdem benötigen Sittiche zur Brut Höhlen, und sie brüten nur 1x im Jahr.
Zum Vergleich: Bei den Straßentauben ist das anders. Tauben können ihre Eier überall ablegen, solange sie von der Unterlage (zum Beispiel einer Fensternische) nicht wegrollen. Und Tauben brüten mehrfach im Jahr.
2. Die Sittiche haben keine natürlichen Fressfeinde
Nein, das trifft nicht zu. Auch wenn Sie den Hinweis auf fehlende natürliche Feinde in vielen Zeitungsartikeln finden und sich diese Annahme dadurch hartnäckig in der Öffentlichkeit hält, so ist sie trotzdem nicht richtig. Tatsache ist, dass sowohl Wanderfalken als auch Habichte regelmäßig die Sittiche bejagen und auch erbeuten. Zudem werden die Sittiche nachts in ihren Schlafbäumen immer wiedermal Opfer von Waldkäuzen, und in den Höhlen werden sie gelegentlich von Mardern erbeutet. Sogar Krähen attackieren Sittiche, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Allerdings haben die Fressfeinde keinen nennenswerten Einfluss auf die Bestandsentwicklung der Sittiche.
3. Die Sittiche nehmen den einheimischen Vögeln die Bruthöhlen & die Nahrung weg
Nein, nach den bisherigen Erkenntnissen trifft das nicht zu. Fakt ist, dass bisher keine heimische Art durch die Anwesenheit der Sittiche in ihrem Fortbestand bedroht ist. Dieses Thema ist sehr komplex und wird unter Ornithologen regelmäßig diskutiert. Ganz allgemein würde man annehmen, dass es nur eine gewisse Anzahl von Baumhöhlen gibt und die Vogelarten diese Höhlen dann unter sich aufteilen müssen. So einfach ist es aber nicht, da die Sittiche mit ihrem kräftigen Schnabel auch vorhandene Baumhöhlen erweitern und so erst für größere heimische Vogelarten nutzbar machen.
Hohltauben können zum Beispiel von den Aktivitäten der Sittiche auch profitieren. Außerdem bevorzugen manche Vogelarten andere Baumarten als die Sittiche. Stare zum Beispiel brüten gerne in Eichen. Auch brüten manche heimischen Vögel lieber in einer anderen Höhe oder an einer anderen Stelle im Baum als die Sittiche. Auf der anderen Seite führt die Vergrößerung vorhandener Höhlen durch die Sittiche dazu, dass kleinere Höhlen für Meisen und Kleiber wegfallen können. Und natürlich kommt es auch immer wieder mal mit anderen Vögeln zu "Rangeleien" um Höhlen, zum Beispiel mit Dohlen. Dohlen sind aber ebenfalls wehrhafte und häufige Vögel in Deutschland. Oft gehen heimische höhlenbrütende Arten aus ganz anderen Gründen zurück: Stare leiden zum Beispiel unter dem Rückgang der Insekten, während Sittiche reine Vegetarier sind.
Die Nahrung der Sittiche setzt sich zusammen aus zahlreichen Pflanzenarten. Bevorzugt werden Pflanzenteile der Rosskastanie, Hainbuche und Ahornblättrigen Platane aufgenommen, wobei die letzten beiden Wintersteher sind und die Sittiche auch in der kalten Jahreszeit ernähren. Die Sittiche sind somit auch im Winter auf eine Zufütterung durch den Menschen nicht angewiesen. Die Platane ist mit rund 6.000 Bäumen die häufigste Baumart in der Kölner Innenstadt.
4. Die Sittiche übertragen Krankheiten auf heimische Vögel
Nein, das trifft nicht zu. Nach bisherigem Kenntnisstand übertragen die Sittiche keine Krankheiten auf heimische Arten. Der Kot und das Blut der Sittiche wurden von Biologen entsprechender Institute bereits mehrfach untersucht.
5. Die Sittiche übertragen Krankheiten auf den Menschen
Nein. Bisher ist uns kein Fall bekannt, wo sich in Deutschland ein Mensch durch die freilebenden Sittiche infiziert hat.
Foto: NABU Stadtverband Köln
Auch theoretisch ist die Gefahr äußerst gering. Bei einem Ausbruch der Vogelgrippe müsste man für eine Ansteckung schon in direkten Kontakt mit infizierten Vögeln kommen. Generell kann jeder Vogelkot Krankheitserreger enthalten. Für eine Ansteckung müsste man den Vogelkot dann aber in den Mund nehmen oder einatmen, wenn man zum Beispiel eingetrockneten Vogelkot von der Kleidung verreibt. Aber auch dann ist die Gefahr einer Ansteckung äußerst gering. Wer ganz sicher gehen möchte, sollte Vogelkot immer unter Verwendung von Wasser entfernen.
6. Die Sittiche plündern Obstbäume in Gärten und Obstplantagen
Ja, das kann leider passieren. Sittiche können in Gruppen in Gärten einfallen und dort Obstbäume plündern. Von unseren heimischen Staren kennt man dieses Verhalten auch.
7. Die Sittiche machen Lärm am Schlafplatz
Ja und nein. Die Sittiche lärmen beim Eintreffen in die Schlafbäume und dann wieder kurz vor dem morgendlichen Abflug. Aber während der Nacht ist es an den Schlafplätzen still, man kann sprichwörtlich „die Stecknadel fallen hören“.
8. Die Sittiche kacken am Schlafplatz alles zu
Ja, das ist leider so. Die Akzeptanz eines Schlafplatzes in der Bevölkerung hängt deshalb sehr vom Standort und den Reinigungsintervallen der Stadtreinigung ab. Problematisch sind Schlafbäume in unmittelbarer Nähe zu Außengastronomie, Haltestellen des ÖPNV und Wohnhäusern.
9. Die Sittiche beschädigen die Hausfassaden
Ja, das trifft leider zu. Sittiche nutzen insbesondere durch Spechte verursachte Löcher an Gebäudefassaden zur Brut und vergrößern mit ihrem kräftigen Schnabel die Löcher und somit auch die Schäden. Der Kölner NABU hat ein Faltblatt mit Informationen zu Fassadenbruten von Sittichen erstellt. Es richtet sich an Hauseigentümer/innen und bietet praktische Tipps zum Schutz der Hausfassade und zum artenschutzgerechten Umgang mit Fassadenbruten.
Das Faltblatt ist in der Geschäftsstelle und als PDF-Download auf unserer Homepage erhältlich.
Wenn Sie Probleme mit Sittichen an oder in der Hauswand haben, kontaktieren Sie also gerne unsere Geschäftsstelle.
10. Die Sittiche fliegen schneller als die Polizei erlaubt
Ja, das kommt tatsächlich vor. Im pfälzischen Zweibrücken wurde 2016 von der Polizei ein Halsbandsittich mit 43 km/h in einer Tempo-30-Zone geblitzt. Die Polizeidienststelle nahm den Vorfall mit Humor: “Von wem das fällige Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro entrichtet wird, steht derzeit noch nicht fest“, hieß es im Bericht…